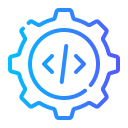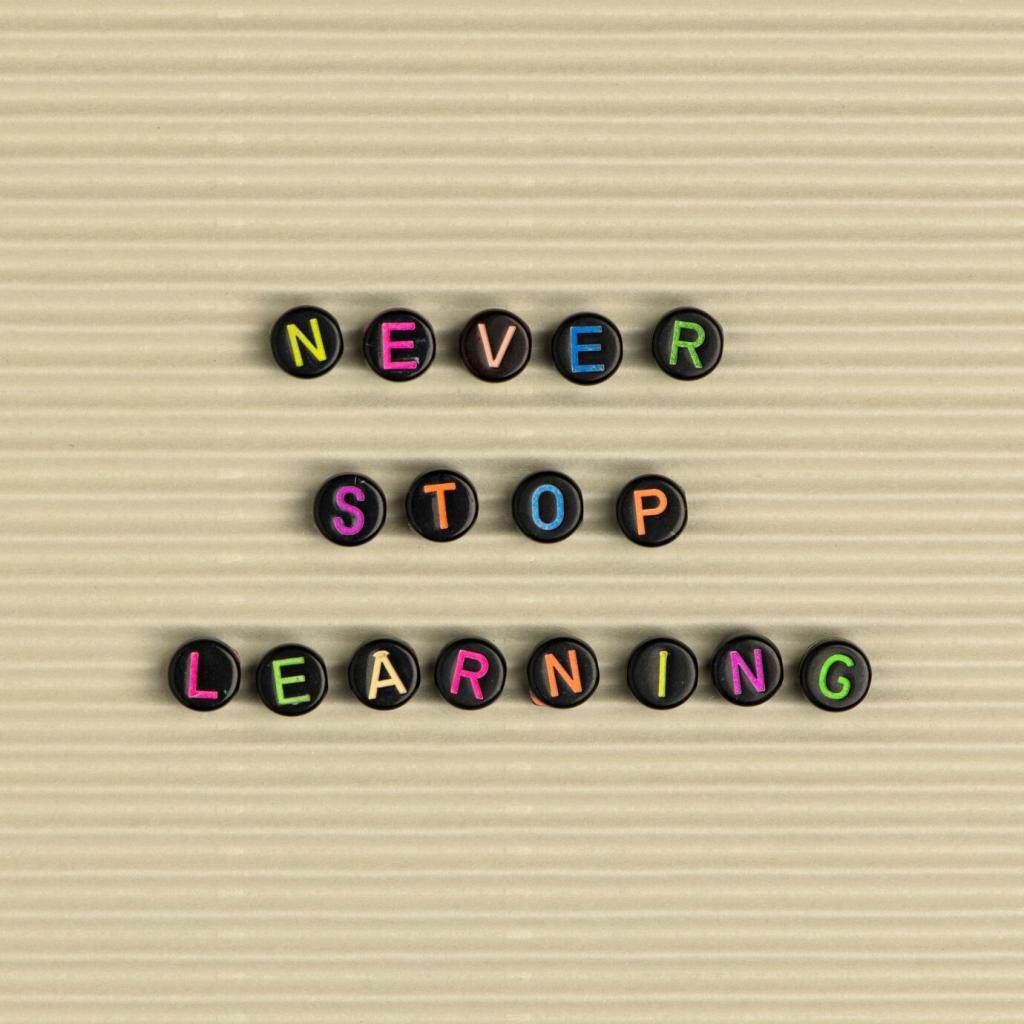Begriffe richtig einordnen: Low-Code vs. No-Code
Sowohl Low-Code als auch No-Code setzen auf visuelle Bausteine, Drag-and-Drop und vorkonfigurierte Komponenten. Der Unterschied liegt in der Tiefe der Anpassung: No-Code abstrahiert stärker, Low-Code lässt bei Bedarf den Blick und Zugriff unter die Haube zu.
Begriffe richtig einordnen: Low-Code vs. No-Code
No-Code vermeidet manuelle Programmierung konsequent und setzt klare Leitplanken. Low-Code ermöglicht Erweiterungen mittels Skripten oder Microservices, wenn Standard-Bausteine nicht ausreichen. Dadurch entsteht zusätzliche Flexibilität, aber auch Verantwortung für Qualität.